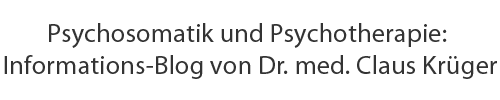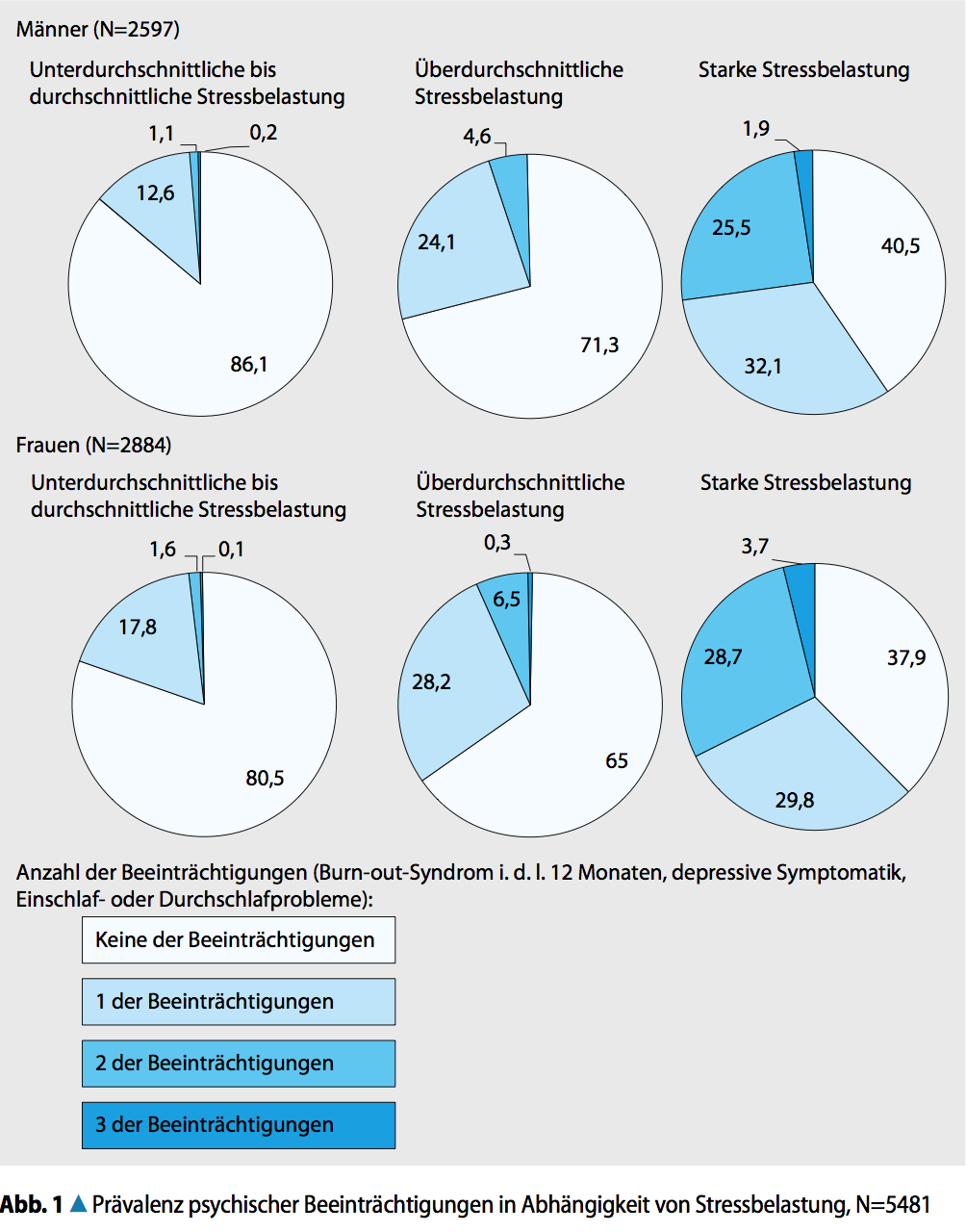Chronische Belastungen und chronischer Stress machen krank, wie viele Studien und auch mehrere Beiträge in diesem Blog belegen. Um leistungsfähig zu bleiben oder die „Performance“ noch zu steigern, greifen jedoch immer mehr Menschen in Studium und Beruf zu Medikamenten.
Nach Umfragen der Krankenkassen geben 5% der Erwerbstätigen und Studenten an, schon einmal Medikamente zur Leistungssteigerung eingenommen zu haben. Das belegt auch eine Studie der Universität Bielefeld mit 3486 Studenten. Der SPIEGEL berichtete im Januar 2013 von 20% der Studenten, die Hirndoping betreiben. In Untersuchungen aus den USA wird die Häufigkeit von Medikamenten zur Leistungssteigerung ebenfalls mit 20% unter Studenten angegeben.
Im Projekt FAIRUSE der Soziologischen Fakultät Bielefeld wird versucht, Studienbedingungen zu schaffen, die Hirndoping und andere Praktiken nicht notwendig machen.
Menschen, die Medikamente zum Hirndoping einsetzen, versuchen in der Regel, wacher, konzentrierter und leistungsfähiger zu sein, aber auch Ängste abzubauen und das Wohlbefinden zu steigern.
Bei den Substanzen, die eingenommen werden, handelt es sich in erster Linie um Amphetamine, deren Verwandte (z.B. Methylphenidat: Ritalin*) und weitere illegale Drogen. Für nähere Informationen zu den Medikamenten verweisen wir auf die Website der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V.
Die Nebenwirkungen sind nicht harmlos: zu zahlreichen körperlichen Beschwerden (Kopfschmerzen, Unruhe, Schlafstörungen, Atemnot, Herzprobleme Blutdruckschwankungen, Vergiftungserscheinungen) kommen eine ganze Reihe von psychischen Problemen und Erkrankungen (Ängste, Depressionen, Burnout, plötzliche aggressive Ausbrüche und Verfolgungswahn) und nicht zuletzt die Abhängigkeit von den Doping-Mitteln.
Besonders anfällig für Hirndoping sind Menschen, für die nur Leistungen zählen. Oft haben sie immer wieder die Erfahrung gemacht, nur über ihre Leistungen wahrgenommen zu werden. Immer wieder werden so auch Unsicherheiten und Ängste mit Leistungssteigerung überspielt.
Eine ähnliche Dynamik habe ich vor einigen Wochen bei dem Thema Selbstoptimierung unter der Überschrift: „Schöner,schlanker und gesünder. Wozu dient die Selbstoptimierung“ beschrieben.
Der regelmäßige Gebrauch von Medikamenten zur Leistungssteigerung führt aber unweigerlich zu einer Spirale, die die Betroffenen irgendwann nicht mehr aufhalten können. Manche müssen auch die Erfahrung machen, dass die erbrachten Leistungen nie genug sind und sie nie zur Ruhe und Zufriedenheit kommen. Dann hetzen diese „Leistungsträger“ von Erfolg zu Erfolg. Doch sie können diese Erfolge immer weniger geniessen, sondern müssen immer weiter, immer höher. So stellt sich eine Sucht nach Erfolg ein, der allein schon lange nicht mehr befriedigt.
Machmal ist eine Erkrankung für die Betroffenen der einzige Ausstieg ohne Gesichtsverlust aus diesem Kreislauf . Denn auch der Ausstieg aus der Leistungsspirale macht Angst. Gut, wenn bis dahin niemand zu schaden gekommen ist (z.B. durch Verletzungen, Unfälle oder Risikoverhalten).
Spätestens dann sind aber professionelle Unterstützung, Beratung und Therapie notwendig.
Manchmal muss vor eine Psychotherapie erst ein körperlicher Entzug gemacht werden.
Langfristig kommen die Betroffen aber nur zurecht, wenn sie ihre Leistungsideale in Frage stellen und sich klar machen, was sie mit Leistung und Erfolg kompensieren wollten. Dann ist nicht nur eine Verhaltensänderung, sondern auch eine Veränderungen der Einstellungen möglich. Das geht in der Regel nur mit einfühlsamer, professioneller Therapie z.B. in einer Psychosomatischen Behandlung.