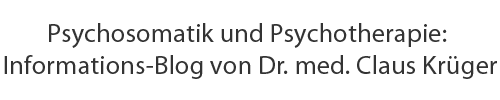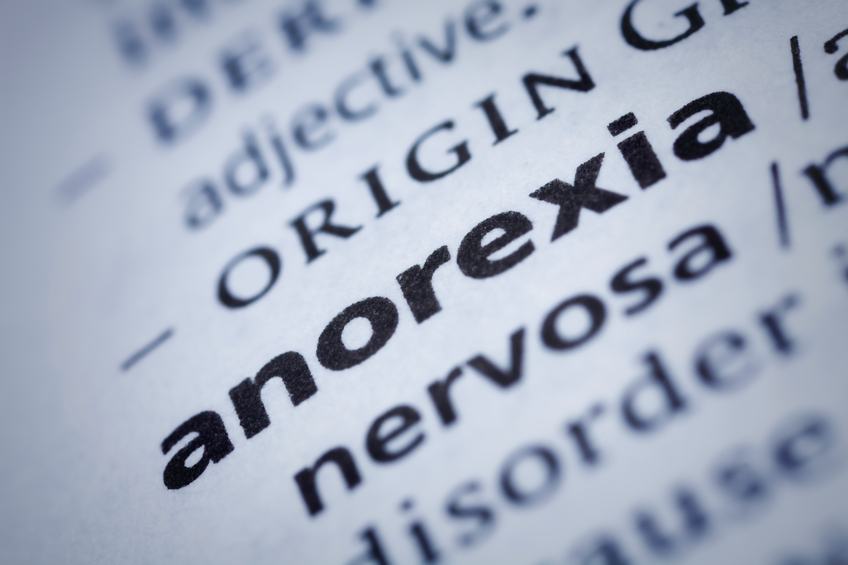Zwang schadet in der Behandlung der Magersucht
Die Zahl von Frauen mit Essstörungen , die sich in der Psychosomatischen Abteilung in Ebersberg haben behandeln lassen, hat sich in den letzten Jahren verdoppelt (SZ 09.06.2016). In den letzten Monaten kamen zudem viele Frauen mit Essstörungen zur Beratung, die von gescheiterten Behandlungen berichteten.
Das verwundert nicht. Denn für die Behandlung von Menschen mit Essstörungen braucht es sehr viel Erfahrung und eine transparente, eindeutige therapeutische und ethische Haltung (s.u.).
Die meisten Betroffenen berichten, dass die Schwere der Essstörung zu Beginn unterschätzt worden ist, und sich die Symptomatik trotz Behandlungen verschlechtert hat.
Die andere Problematik in der Behandlung von Essstörungen, von der die Patientinnen berichtet haben, besteht im viel zu häufigen Einsatz von Zwangsmaßnahmen und von Behandlungen gegen den Willen der Patientinnen mit Bulimie und Anorexie.
Und das ist für die Betroffenen oft fatal, weil sie nur die Möglichkeit sehen, sich entweder anzupassen (und z.B. gegen ihren Willen Gewicht zuzunehmen) oder die Behandlungen abzubrechen.
Im Folgenden will ich das Problem am Beispiel der Pubertäts-Magersucht (Anorexia nervosa) beschreiben:
Bei den Betroffenen handelt es sich zu 95 % um Mädchen und junge Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen absichtlich eine Gewichtsabnahme herbeiführen (durch Hungern, exzessiven Sport, Erbrechen, Abführmittel, sonstige Medikamente usw.).
In fast allen Behandlungen von Ärzten und Therapeuten, in Praxen, Klinken und Beratungsstellen werden die Frauen mit Untergewicht zur Gewichtszunahme überredet, gedrängt oder gezwungen. (Damit machen die Ärzte und Therapeuten genau das, was den Betroffenen in den Familien, im Bekanntenkreis und und in Partnerschaften auch immer wieder passiert).
Doch wozu führt das?
Frauen mit Essstörungen haben gelernt, sich anzupassen, zu unterwerfen und ihre Absicht, Gewicht zu reduzieren, zu verheimlichen. Sie passen sich nach außen an die Erwartungen an und verheimlichen ihre wahren, inneren Motive oder wirklichen Absichten.
Schon vor 20 Jahren wurde in britischen Studien nachgewiesen, dass die Heimlichkeiten zunehmen, je größer der Druck und Zwang auf die Betroffenen mit Essstörungen ist (Gowers 1992).
Das heisst auch, dass in Therapien die mit Zwang arbeiten, die Chancen vertan werden, Vertrauen aufzubauen, in dem sich die anorektischen Frauen verstanden fühlen und offen, über ihre Wünsche und Ängste reden können.
Denn immer gibt es Gründe dafür, dass Mädchen und Frauen trotz intensiver Kenntnisse über Ernährung, Nahrungsmittel und die medizinischen Folgen absichtlich hungern oder sich „ungesund“ ernähren.
Leider arbeiten aber die meisten psychosomatischen und psychiatrischen Kliniken mit einem Behandlungskonzept, in dem die Patientinnen von Anfang an Gewicht zunehmen müssen.
Damit wird oft die Chance vertan, die zum Teil unbewussten Gründe zu verstehen und den Betroffenen zu helfen, andere Lösungen für ihre Konflikte und Probleme zu finden.
Dabei ist das der einzige, nachhaltige Weg raus aus einer Essstörung, hin zu einem selbstgesteuerten und selbstbewussten Leben.
Deshalb besteht die Hauptaufgabe einer Psychotherapie darin, zu verstehen, in welcher Not die betroffenen Frauen sind, warum sie Gewichtsabnahme als Lösung ihrer Probleme sehen und mit ihnen Alternativen zu er arbeiten, die die Essstörung überflüssig macht.
Das konnte ich mit Kolleginnen vor 20 Jahren in der Psychosomatischen Abteilung im Klinikum rechts der Isar an einer kleinen Gruppe von untergewichtigen, anorektischen Frauen (BMI um 13 kg/m2) nachweisen.
Wir haben die Betroffenen mit Einzel- und Gruppentherapie zusammen mit Hausärzten behandelt und von Ihnen lediglich verlangt, ihr Gewicht zu halten. Die Hälfte der Frauen hat im Laufe der Behandlung von sich aus an Gewicht zugenommen. Die andere Hälfte ist anschliessend in weitere Therapien gegangen.
Deshalb arbeiten wir in der Psychosomatik seit Jahren nach einem anderen Konzept in der Behandlung von Frauen mit Essstörungen:
Wir setzen den Schwerpunkt nicht auf die Symptome (Untergewicht, Hungern, Erbrechen…..) und die Veränderung des Essverhaltens, sondern konzentrieren uns darauf, zuerst ein Vertrauen aufzubauen und mit den Betroffenen die z.T. unbewussten Ursachen für das Essverhalten und das Untergewicht zu erkunden.
Denn nur wenn die Not der Frauen gespürt und die Essstörung als gescheiteteter Versuch einer Konfliktbewältigung verstanden wird, sind die Betroffenen in der Lage, selbst und von sich aus Gewicht zuzunehmen. Das kann länger dauern, ist aber nachhaltig erfolgreicher.
Und sollte neben der Essstörung ausserdem eine schwere Traumatisierung oder eine Borderline Persönlichkeit bestehen, ist es noch wichtiger den anorektischen Frauen zuerst zu helfen, mit Selbstwertzweifeln und Selbsthass und Selbstschädigung zurecht zu kommen, bevor die Essstörung therapeutisch behandelt werden kann. Denn bei schwerer Persönlichkeitsstörung (v.a. durch Traumarisierungen) haben Zwangsmaßnahmen ganz verheerende, negative Folgen.
Zum Schluss ein Hinweis für Kollegen (Psychiater, Verhaltenstherapeuten und Ärzte): selbstverständlich besteht das langfristige Ziel jeder Behandlung darin, das die Betroffenen die Symptome aufgeben zu können. Doch dazu sind Voraussetzungen notwendig, die zusammen mit den anorektischen Frauen und nicht gegen sie erarbeitet werden muss.
Dabei darf man die Gefahren für die Gesundheit nicht übersehen. Deshalb müssen die Frauen mit Essstörungen genau untersucht werden, immer medizinisch und therapeutisch behandelt werden und über die gesundheitlichen Risiken und Gefahren aufgeklärt werden.
Bei der Gelegenheit erfährt man als Arzt oder Therapeut aber auch, dass die wenigsten Betroffenen mit Essstörungen die Absicht haben, ihr Leben zu beenden (ganz gegen die Angst der Familien und mancher behandelnden Ärzte).